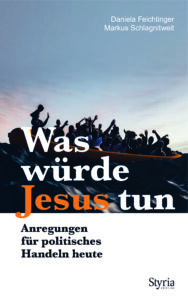Christkönig – C: Lk 23,35-43
(Linz − Ursulinenkirche, 23. XI. 2025)
Kann man sinnvoll Christkönig feiern in einer Zeit, die geprägt ist vom allmählichen Zerfall liberaler, rechtsstaatlicher Demokratien in Autokratien, deren populistische Führer sich aufspielen wie Pseudokönige: in den USA, in der Türkei, in Polen, Ungarn und der Slowakei, von Staaten in anderen Kontinenten ganz zu schweigen? Wird durch diese machtgeilen Möchtegern-Könige nicht die Idee des Königtums an sich desavouiert, sodass man sie am liebsten ins Reich der Märchen verbannen möchte?
Oder muss man nicht gerade in solchen Zeiten Christkönig feiern? Ist die ursprüngliche Idee und politische Stoßrichtung dieses kirchlichen Festes nicht gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen weltpolitischen Entwicklungen aktueller denn je? Die Einführung dieses Festes geht jedenfalls auf das Jahr 1925 zurück – eine nicht weniger von multiplen Krisen geprägte Zeit wie heute. Und nicht weniger als heute neigten viele Menschen jener Zeit dazu, angesichts der vielen Herausforderungen und Probleme irgendwelchen, vermeintlich starken Führern nachzulaufen und ihren wohlfeilen, aber falschen Versprechungen und Problemlösungen auf Kosten wehrloser Dritter zu glauben.
Gegen all diese falschen Könige lautete die hochpolitische Botschaft des Christ-königsfestes: Es gibt für gläubige ChristInnen keinen anderen Gott als den Gott Jesu Christi. Es gibt kein anderes Heil als das im Evangelium verkündete Gottesreich. Es gibt keinen anderen Herrn, in dessen Dienst man sich bedingungslos stellen kann, als den König Christus. Gegen die kommunistische Königsidee der Klasse, gegen die faschistisch-nationalistische Königsidee der Rasse, gegen die kapitalistische Königsidee der Kasse ist die Königsvorstellung des Christentums eine grundsätzlich andere: Das Christkönigsfest krönt keinen König der Macht und Stärke, der Überlegenheit und des Reichtums, sondern: den König am Kreuz. Wer hier also gekrönt wird – das ist kein Mächtiger und Starker, kein Siegertyp und kein besonders Schlauer. Nein – mit dem König am Kreuz sind all jene am anderen Ende der gesellschaftlichen Hierarchie gekrönt: die Ohnmächtigen und Schwachen, die um der Gerechtigkeit und Wahrheit willen Gescheiterten, die Habenichtse und die Kranken. Das sind die wahren Könige des Christentums. Auf sie muss sich der Blick und der Dienst, die Verantwortung und die Sorge aller Getauften richten.
Damit aber noch nicht genug. Muss der eigentlich absurde Tod des Königs Christus am Kreuz nicht noch radikaler gedeutet werden? – Wir neigen vielleicht zu sehr dazu, den gekreuzigten Christus sozusagen als „tragischen Helden“ zu verehren: gefallen im heroischen Kampf gegen die bösen Mächte dieser Welt, von Gott aber postum zum Sieger erklärt. Was aber, wenn wir bei der Betrachtung des Kreuzestodes Jesu einmal fern aller Heldendramatik die ganze Absurdität gelten lassen, die in dieser Szenerie selbst steckt? Könnte es nicht sein, dass Jesus, angefangen bei seiner aus dem Munde eines Gefangenen geradezu irrwitzigen Selbstbehauptung vor Pilatus („Ja, ich bin ein König.“) – könnte es nicht sein, dass er auch noch in seiner Paradiesesverheißung an den „guten Schächer“, also gegenüber dem Letzten, der ihn aller Logik zum Trotz immer noch als König anerkennt – könnte es nicht sein, dass Jesus hierin selbst jeglicher Königsvorstellung spottet und jegliche Königsidee ad absurdum führt – sei sie nun politisch, wirtschaftlich oder auch religiös bzw. moralisch motiviert und begründet?
Dann aber wäre das Christkönigsfest nicht nur als Kritik an allen politischen Rattenfängern zu feiern, sondern als Spottlied auf überhaupt jeglichen menschlichen Autoritätsanspruch, und sei er auch religiös konnotiert. Dann hieße die Botschaft des Christkönigsfestes: Wenn der Mensch Ebenbild Gottes ist, dann muss er es in aller Radikalität sein; dann darf er sich gerade aufgrund dieser Gottes-Ebenbildlichkeit keiner anderen Macht mehr beugen und keiner höheren Autorität mehr verpflichtet werden als allein seinem Glauben und seinem Gewissen. – Ob ein Machthaber dieser Erde nun eine oder – wie noch der damalige Zwischenkriegspapst Pius XI. – gleich drei Kronen auf seinem Haupt trägt, die vielleicht einzige externe Autorität, der Christ:innen verantwortlich sind, ist der leidende Mensch.